[ Einführung ] [Instumente ] [Stativ ] [Optik ] [Mechanik
] [Zum Kauf eines Fernglases ] [Empfehlung ] [Reinigung und Pflege ]
[Literatur ] [Beobachten ] [Objekte ]
Für Anfänger wie auch für eingefleischte Amateurastronomen sind Ferngläser ein leichtes, praktisches und vor allem günstiges Mittel, um eindrückliche Beobachtungsabende zu verbringen. Der Vorteil dieser Instrumente ist, dass sie nicht ausschliesslich für astronomische Zwecke verwendbar sind: Naturbeobachtungen von Vögel, Wild und Landschaften, aber auch das Näherholen von Flugzeugen ist ein weiteres, beeindruckendes Erlebnis. Für Astronomen ist aber der galaktische Spaziergang in der Milchstrasse ein Höhepunkt. Eine nützliche Dokumentation von Zeiss über Ferngläser: wissenswertes_ueber_fernglaeser.pdf
|
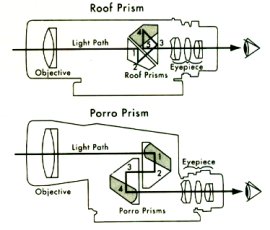 Es gibt zwei wesentliche
Typen von Feldstechern, die sich in der Bauform unterscheiden: Dachkantprismen (auch Roof Prism genannt) und Porroprismen. Die Prismen
falten den Strahlengang, um die Baulänge zu verkürzen.
Kleinere Ferngläser sind meist mit Dachkantprismen gebaut, womit sie sich auch äusserlich von den grösseren
unterscheiden. Der Fernglastubus ist dann ein Rohr. Es gibt zwei wesentliche
Typen von Feldstechern, die sich in der Bauform unterscheiden: Dachkantprismen (auch Roof Prism genannt) und Porroprismen. Die Prismen
falten den Strahlengang, um die Baulänge zu verkürzen.
Kleinere Ferngläser sind meist mit Dachkantprismen gebaut, womit sie sich auch äusserlich von den grösseren
unterscheiden. Der Fernglastubus ist dann ein Rohr.Optisch unterscheiden sich die Prismentypen eigentlich nur den verwendeten Glastyp und deren Vergütung. Porroprismen sind meist häufiger bei lichtstarken Geräten von Astronomen zu finden. |
Ein stabiles und genügend hohes Fotostativ ist empfehlenswert, so bleibt das Bild während den Beobachtungen ruhig. Bei einem ruhigen Bild sind mehr Einzelheiten erkennbar. Zudem strengt das freihändige Beobachten auf Dauer an. Am Stativ sollte nicht gespart werden, denn die günstigsten sind oft nicht stabil und hoch genug.
|
|
Glas und Vergütung
 Die Optik ist das
Wichtigste an einem
Feldstecher. Günstige Feldstecher enthalten oft billige
Gläser, die weniger Licht durchlassen. Gute Gläser haben
Bak-4 Prismen. Bei billigen Gläser fehlt oft eine Vergütung,
die die Reflexion des Lichts an Luft-Glas-Flächen verringert.
Die Bezeichnungen der Vergütungen
sind oft widersprüchlich und leider nicht einheitlich. Als
Faustregel gilt: je mehr Glasflächen mehrschichtig vergütet
sind,
desto besser. Beim
Kauf soll
darauf geachtet werden, dass die Glasflächen beim Halten gegen
eine Lichtquelle diese nur leicht violett, grünlich oder rötlich
schimmernd reflektiert. Dies ist ein Indiz für eine Vergütung. Ist die
Reflexion ähnlich wie bei einer Fensterscheibe (hell weiss),
so ist keine Vergütung vorhanden. Auf nebenstehendem Bild ist eine
Optik mit guter Vergütung zu sehen (violette, blaue Flächen). Die Optik ist das
Wichtigste an einem
Feldstecher. Günstige Feldstecher enthalten oft billige
Gläser, die weniger Licht durchlassen. Gute Gläser haben
Bak-4 Prismen. Bei billigen Gläser fehlt oft eine Vergütung,
die die Reflexion des Lichts an Luft-Glas-Flächen verringert.
Die Bezeichnungen der Vergütungen
sind oft widersprüchlich und leider nicht einheitlich. Als
Faustregel gilt: je mehr Glasflächen mehrschichtig vergütet
sind,
desto besser. Beim
Kauf soll
darauf geachtet werden, dass die Glasflächen beim Halten gegen
eine Lichtquelle diese nur leicht violett, grünlich oder rötlich
schimmernd reflektiert. Dies ist ein Indiz für eine Vergütung. Ist die
Reflexion ähnlich wie bei einer Fensterscheibe (hell weiss),
so ist keine Vergütung vorhanden. Auf nebenstehendem Bild ist eine
Optik mit guter Vergütung zu sehen (violette, blaue Flächen). |
Austrittspupille:
 Hält
man das Okular des Fernglases
ca. 50 cm von sich weg, so erkennt man in den Okularen ein kleines,
helles Scheibchen, Austrittspupille genannt. Um möglichst viel
Licht zu sammeln soll ein Fernglas für astronomische Verwendung
eine Austrittspupille von über 4.5 mm haben. So können die
an die Dunkelheit angepassten Augen das Licht auch aufnehmen. Hält
man das Okular des Fernglases
ca. 50 cm von sich weg, so erkennt man in den Okularen ein kleines,
helles Scheibchen, Austrittspupille genannt. Um möglichst viel
Licht zu sammeln soll ein Fernglas für astronomische Verwendung
eine Austrittspupille von über 4.5 mm haben. So können die
an die Dunkelheit angepassten Augen das Licht auch aufnehmen.Das Berechnen der Austrittspupille erfolgt mit folgender Formel: Austrittspupille = Öffnung / Vergrösserung. Ein durchschnittliches Auge hat in der Dunkelheit eine maximale Pupillengrösse von 7mm. Es ist die Überlegung Wert ob wirklich 7 mm Austrittspupille benötigt werden, denn eher selten sind die Augenpupillen so weit geöffnet. Je nach dem ist es deshalb ratsam stärker zu vergrössern. Sind die Augenpupillen kleiner als die Austrittspupille, so wird eine kleinere Lichtmenge von den Augen aufgenommen. Durch dieses Abblenden wird nicht der ganze Objektiv-Duchmesser zur Lichtsammlung ausgenützt. |
Vergrösserung:
Da streiten sich oft sogar die
Götter darüber, welche die richtige ist. Die einen
schwören auf eine möglichst grosse Austrittspupille
und passen dann die Vergrösserung an, die anderen schwören
auf eine 10-fache Vergrösserung, da dies noch eine Beobachtung mit
freier Hand ermöglicht. Ab 12-facher Vergrösserung ist ein
Stativ notwendig.
Es ist sinnvoll, über
die Vergrösserung nachzudenken, da bei einer kleineren
Vergrösserung Objekte eher übersehen werden. Eigene
Erfahrungen bestätigen einen älteren Bericht von
Sky&Telescopes, dass Objekte wegen einer zu geringen Vergrösserung oft übersehen werden. Deshalb spricht sehr vieles
für eine stärkere Vergrösserung. Eine ruhige
Hand kann einen 10x50 Feldstecher problemlos fast ruhig halten. Es
lohnt sich sehr, Ferngläser mit "Zwischengrössen" (9x56
oder 10x65) in Betracht zu ziehen.
Zoom:
Neben den festvergrössernden Ferngläsern
gibt es solche, die über ein Zoom verfügen. Diese
Ferngläser mögen eine tolle Sache bei Tageslicht sein. Da ein
Zoom-Fernglas mehr Linsen benötigt, wird das schwache Licht von
Objekten noch mehr absorbiert. Demzufolge sind Zoom-Ferngläser
weniger lichtstark als vergleichbare festvergrössernde
Ferngläser. Meist wird bei
Zoom-Ferngläsern das Blickfeld stark eingeschränkt, so dass
ein Röhrenblick entsteht. Billige Zoomferngläser müssen
während dem zoomen in der Schärfe nachgestellt werden, was
ein
sehr grosser Nachteil ist.
Blickwinkel:
Für genussvolle Beobachtungen sind
weitwinklige Gläser
ein Traum. Ab ca. 50° Sehwinkel verschwindet der Eindruck eines
Röhrenblickes, der oft bei billigen Ferngläsern zu beobachten
ist. Je grösser der Sehwinkel ist, desto eher kann sich eine
Randunschärfe bemerkbar machen. Je nach individuellem Empfinden
kann dies dennoch störend wirken, wenn die Sterne am Rand nicht
mehr scharf erscheinen. Die Randunschärfe wird jedoch oft
gar nicht richtig bemerkt, da das Auge nur in der Mitte wirklich scharf
sieht. Am Blickfeldrand nimmt beim Auge die Sehschärfe und Farbempfindlichkeit ab, dafür wächst die Empfindlichkeit in
Grautönen.
Stickstoff-Füllung:
Teurere Ferngläser sind mit
Stickstoff gefüllt, der ein innenseitiges Beschlagen der Optik
verhindern soll. Bei meinen Beobachtungen mit einem
luftgefüllten Fernglas ist mir ein Beschlagen im Innernnoch nie
aufgefallen. Ist einmal die äussere Linsenfläche beschlagen,
lässt sich diese mit dem warmen Luftstrom eines Föhns wieder
vom Beschlag befreien. Dazu halte man das Fernglas in ca. 40 cm
Entfernung und warte mit etwas Geduld, bis der Beschlag weg ist. Auf dem
freien Feld kann das Fernglas auch während Nichtgebrauchs
am Körper gewärmt werden, so dass sich kein Tau bildet.
Billige Ferngläser haben optisch wie auch mechanisch eine geringere Qualität. Dies erkennt man leicht am Spiel der Fokussierung (Mitteltrieb) und an der unerwünschte Beweglichkeit der Okulare. Jedoch lässt sich der Sternenhimmel auch mit günstigen Gläsern beobachten. Billige Ferngläser wirken oft wackelig, teurere hingegen sind auch mechanisch robust. Gute Gläser haben ein ergonomisches Design.
Vor
einem Kauf soll man sich entscheiden, welche
Vergrösserung man wählt und welches Budget einem zur Verfügung steht.
Danach sucht man sich einen Fotofachhändler oder Optikladen auf,
der eine grössere Auswahl an verschiedenen Ferngläser und
Marken hat. Ein Quervergleich diverser Ferngläser in verschiedenen
Preisbereichen lohnt sich sehr. Man wird staunen, welche Unterschiede
es gibt. Geräte in der
Preiskategorie von über 1000 Fr. sind sicher gut. Im Bereich von
230 bis 800 Fr. besteht keine Relation von Preis und optischer
Perfektion!
Einige Hinweise, damit man nichts
Unerwünschtes aufgeschwatzt erhält:
Optische Tests:
Austrittspupillen
:
Hält man das
Fernglas in einer Entfernung von ca. 50 cm und schaut
durch die Okulare, so sieht man die Austrittspupillen, welche
möglichst rund und gleichmässig hell sein sollten. Kleine
Abweichungen
von der Kreisform sind tolerierbar.
|
Carrena 7x50 eckige Austrittspupille |
Minolta Activa 10x50 runde, gleichmässige Austrittspupille = Idealsituation |
Gerade Linien - Parallele Bilder:
 Ein weiterer Test analysiert senkrechte und
waagrechte Linien (Beispiel Hausmauern). Diese Linien sollten
ungekrümmt wiedergeben werden, sowohl in der Mitte und vor allem am
Rand.
Ein weiterer Test analysiert senkrechte und
waagrechte Linien (Beispiel Hausmauern). Diese Linien sollten
ungekrümmt wiedergeben werden, sowohl in der Mitte und vor allem am
Rand.Die Beobachtung in einem Fernglas ermüdet, wenn die Bilder nicht parallel, sondern horizontal verschoben oder gar verdreht sind. Diese Symptome zeigen sich bei Porro-Prismen-Gläsern, wenn die Prismen verschoben oder dejustiert sind. Kleine Abweichungen sind aus optischer Sicht nicht ganz zu eliminieren (namentlich die Krümmung gegen den Rand hin), aber starke und vor allem ungleich gekrümmte Linien sollten nicht sein, da diese beim Beobachten irritieren und die Augen ermüden. |
Vergütung:
 Durch
Schräghalten der Linsen von
Objektiv und Okular lässt sich eine Vergütung nachweisen, wenn die Reflexionen nicht weiss, sondern meist violett, grünlich
oder rötlich schimmern. Eine Vergütung ist bei einem
Neugerät ein Muss, bei gebrauchten Gläser kann auf
diese verzichtet werden, sofern andere Merkmale eine gute Qualität
aufweisen. Die Finger sollte man aber von defekten
Vergütungen lassen. Dies erkennt man,
dass eine Art Schlieren oder deutlich hellere, klar abgegrenzte
Flächen vorhanden sind, die sich durch Reinigen nicht entfernen
lassen. Durch
Schräghalten der Linsen von
Objektiv und Okular lässt sich eine Vergütung nachweisen, wenn die Reflexionen nicht weiss, sondern meist violett, grünlich
oder rötlich schimmern. Eine Vergütung ist bei einem
Neugerät ein Muss, bei gebrauchten Gläser kann auf
diese verzichtet werden, sofern andere Merkmale eine gute Qualität
aufweisen. Die Finger sollte man aber von defekten
Vergütungen lassen. Dies erkennt man,
dass eine Art Schlieren oder deutlich hellere, klar abgegrenzte
Flächen vorhanden sind, die sich durch Reinigen nicht entfernen
lassen. |
Defekte:
Um sicher zu gehen, dass keine Linsen oder
Prismen durch Stürze
defekt sind, sollte man von vorne durch das Objektiv schauen. Risse
in der Optik oder Absplitterungen verraten sich so sehr schnell. Kleine
Kratzer sind nicht weiter tragisch, aber dennoch ein Grund für
Wertminderung.
Blickfeld - Randschärfe:
Weitwinkligen Gläsern sollte der Vorzug
gegeben werden, denn ein
Röhrenblick ist enttäuschend. Alles über 50° Blickfeld ist gut. Man soll auch auf die Randschärfe achten, indem
man auf einen mittigen Gegenstand scharf stellt. Dann schwenkt man das Glas, bis
das Objekt am Rand ist und schaut nach, wie sich die Schärfe
verhält. Geringe Unschärfen sind kaum vermeidbar, wichtig ist
aber, dass die Unschärfe erst gegen den Rand auftritt und einen
persönlich nicht stört. Am besten betrachte man dazu das
linke und rechte Rohr einzeln.
Brillenträger
Für Brillenträger ist es ratsam,
die Okulare etwas genauer
anzuschauen. Einige Brillenträger beobachten lieber durch ihre
Brille, andere bevorzugen ein Blick ohne Brille durch das
Fernglas. Der Fokus kann von Person zu Person verschieden sein, je nach
Sehstärke. Für Normalsichtige sind Augenmuscheln eine
angenehme Sache, um Streulicht bei den Okularen zu reduzieren. Für
Brillenträger, die mit
Brille beobachten, dürfen diese Augenmuscheln nicht stören.
Oft können diese Augenmuscheln umgestülpt oder entfernt
werden.
Ein Brillenträger soll darauf achten, dass er gut durch den
Feldstecher sehen kann, auch wenn seine Augen weiter vom Okular
entfernt sind als üblich.
Mechanische Tests:
Günstige Ferngläser verraten sich
nicht nur optisch sondern
auch mechanisch. Die Mechanik wirkt eher wackelig und nicht robust.
Meist äussert sich das so, dass der Mitteltrieb Spiel hat
und die Okulare von Hand unerwünscht beweglich sind. Bei guten
Ferngläsern
arbeitet die Fokusierung leichtgängig und spielfrei.
Ein weiteres Kriterium ist, dass das Glas gut und angenehm
in der Hand liegt. Einige Ferngläser sind ziemlich schwer. Dies
soll aber nicht zu einer Ermüdung während des Beobachtes
führen.
Mein Vorschlag ist, ein
weitwinkliges, optisch gutes Fernglas mit 10x50 zu verwenden, das
auch angenehm und gut in der Hand liegt. Es soll einem persönlich
gut gefallen. Ein Stativ und eine Halterung für das Fernglas
unbedingt mitkaufen, sowie entsprechende Himmelskarten (Mein Tip ist
der Karkoschka mehr dazu hier ). Die Preise von Ferngläsern bewegen sich von ca.
150 Fr. an aufwärts, bis einige tausend Franken. Ab ca. 350 Fr.
ist schon etwas Hochwertiges erhältlich. Ferngläser
von namhaften Herstellern zeigen mehrheitlich eine deutlich bessere
Qualität. Dies zeigt sich, dass bei gleichen Öffnungen und
Vergrösserungen schwächere Sterne und Objekte zu sehen sind.
Billigmarken leisten auch ihren Dienst, haben aber eine geringere
Qualität in der Verarbeitung und der Optik. Von
Zoom-Ferngläser und solchen mit elektrischer Stabilisierung rate
ich aus Gründen der optischen Qualität und
des eher kleinen Blickfeldes ab.
Vor dem Kauf sollte ein Fernglas mit anderen
Gläser von anderen Marken verglichen und selektiert werden. Hat
man mehrere gleichwertige Gläser und kann sich nicht entscheiden,
so schaue man,
welches Glas angenehmer in der Hand liegt, leichter, weitwinkliger oder
günstiger ist. Das mitgelieferte Zubehör wie Staubkappen,
Tragriemen
und Tragtaschen sollen auch berücksichtigt werden.
Im Falle von Garantieansprüchen ist man mit grossen, weltweit
vertretenen Herstellern besser bedient als mit Noname-Produkten. Minolta
beispielsweise hat in der Schweiz ein gute Service-Abteilung, die im
Falle von Garantieleistungen vorbildlich schnell und unkompliziert
agiert.
Ein Favorit: Minolta Acitva 10x50W für ca. 400 Fr. (Fühjahr 2000)
Ferngläser
sind sehr
einfach zu handhaben. Es gibt so gut wie nie etwas zu justieren,
anzupassen oder sonst was zum herumbasteln, ausser man geht grob mit dem
Instrument um.
Je nach Einsatz ist eine Reinigung von Zeit zu Zeit nötig. Seien
es Fettablagerungen von den Wimpern an den Okularen oder eingetrocknete
Wasserspritzer oder ein Fingerabdruck am Objektiv. Die einfachste und
sicherste Methode ist die Trockenreinigung mit dem "Lenspen" von "Hama",
erhältlich in den meisten Fotofachgeschäften. Mit diesem
Stift wedelt man
zuerst den Staub weg, anschliesend wird mit einem Lederstöpsel,
bei welchem kleine Graphitpartikel über die Oberfläche
verteilt
werden, um Verschmutzungen binden. Gereinigt wird in radialer Richtung.
Das Gehäuse eines Feldstechers lässt sich mit einem
feuchten, nicht
nassen, Lappen gut reinigen.
Ein kleiner Sternatlas oder Sternführer ermöglicht erst das gezielte Aufstöbern von Objekten und ist unbedingt zu empfehlen. In grossen Buchhandlungen oder in einzelnen Sternwarten ist entsprechende Literatur käuflich. Auch Planetariumprogramme können wertvolle Dienste leisten; richtiges Benützen vorausgesetzt. Oder man verwende meine kleine Sammlung von Objekten für Ferngläser. Auch interessant ist ein Blick auf den aktuellen Himmel .
Eine drehbare Sternkarte (erhältlich unteranderem beim Kosmos-Verlag) ermöglicht eine gute Orientierung am Himmel anhand von Sternbildern.
Mein
persönlicher Liebling ist der "Atlas
für Himmelsbeobachter" von E. Karkoschka, welcher im Buchtip genauer beschrieben ist.
Parametrische Fernglassuche: http://www.orniwelt.de/fernglassuche.php
Die Augen müssen sich
an die Dunkelheit anpassen, um schwache Objekte zu sehen. Schon nach
einigen Minuten Dunkelheit sieht man deutlich mehr und nach ca. 30
Minuten
haben sich die Augen vollständig an die Dunkelheit angepasst.
Der Beobachtungsplatz muss
einige Eigenschaften aufweisen, um gute Beobachtungsergebnisse zu
erzielen: keine Lichtquelle sollte in der Nähe sein, kein Licht
darf direkt blenden und der Himmel sollte, wenn möglich, nicht von
Strassenlaternen oder lästigen Skybeamern aufgehellt sein.
Bäume oder Häuser verdecken störendes Licht relativ gut,
ein aufgehellter Himmel bleibt.
Die Orientierung am Himmel
erfolgt am Anfang anhand von Sternbildern (oder für Anfängermit
dem Kompass), welche mehr oder weniger auffällig von blossem Auge
zu sehen sind. Anschliessend führen einzelne Sterne eines
Sternbildes zum gewünschten Objekt weiter. Auffällige Drei-
oder Vierecke sind eine gute Orientierungshilfe, auch
durch das Fernglas. Solche geometrische Figuren dienen als gute
Anhaltspunkte, um mit einer Sternkarte die beobachtete Region
zu vergleichen. Zum Lesen der Sternkarte empfiehlt es sich, rotes
Licht zu verwenden, da so die Dunkeladaption der Augen bestehen bleibt.
Um sich besser in einem Atlas zurecht zu finden, muss die Grösse des Blickfeldes (am besten in Grad) des Fernglases bekannt sein; am besten zeichnet man dies masstabsgetreu auf eine Folie. Kennt man dies nicht, so gehe man von ca. 5 Grad aus.
Entlang der Milchstrasse lassen sich ganz viele offene Sternhaufen beobachten. Die Milchstrasse ist wahrscheinlich eines der besten und vielfältigsten Objekte für ein Fernglas und hinterlässt jedes Mal eine eindrucksvolle Erinnerung von der Fülle des Universums.
Kugelsternhaufen lassen sich als kleine diffuse Flecken erkennen.
Der Mond ist wunderbar im Fernglas zu sehen, jedoch sollte er meist als letztes Objekt bewundert werden, da wegen seiner Helligkeit die Anpassung der Augen an die Dunkelheit verloren geht. Idealer Zeitpunkt ist die Sichel nach Neumond bis einige Tage nach zunehmendem Halbmond. Ein aufgehender Vollmond ist sehr schön, ein Vollmond hoch am Himmel ist aber eher störend.
Jupiter ist der interessanteste Planet für Ferngläser, da man seine vier grössten Monde (Galileische Monde) Io, Europa, Ganymed und Calisto gut erkennen kann. Sehr interessant ist die Beobachtung über mehrere Tage hinweg. Durch Aufzeichnen der täglichen Beobachtung kann man die Eigenbewegung der Monde gut nachvollziehen. Die Umlaufszeiten dieser Monde reichen von ca. 2-20 Tagen. Mit etwas Geduld lassen sich mit der Zeit die Namen den einzelnen Monde zuweisen, denn Io ist der schnellst Mond, gefolgt von Europa und Ganymed. Calisto ist der langsamste Mond. Mit etwas Glück erkennt man dann auch, dass Jupiter sich bezüglich der Fixsterne bewegt. Diese Bewegung macht ihn zu einem Wanderer, was auf griechisch Planet heisst.
Hellere Gasnebel (Beispiel die Ansammlung im Schützen oder M42 im Orion) und helle Galaxien (Beispiel M31, M51 oder M81, M82) lassen sich als Nebelfleckchen gut beobachten. Jedoch wird man hier in einem grösseren Fernrohr sicher mehr sehen.
Viel Spass beim Beobachten & viel Erfolg beim Kauf eines Fernglases
(c) by Thomas Knoblauch / http://www.star-shine.ch
Einen speziellen Dank gebe ich einem anonym bleibendem Herren. Er half mir tatkräftig bei der Fehlerkorrektur.